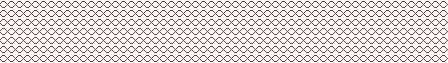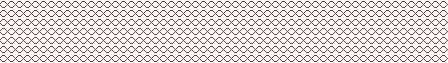

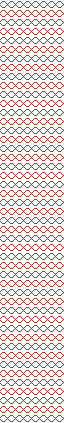
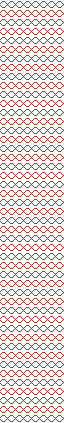
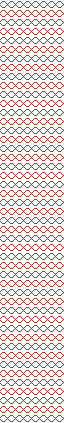
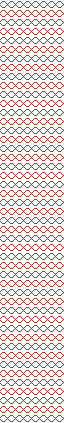
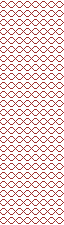
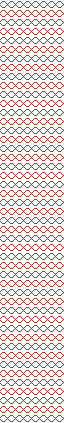
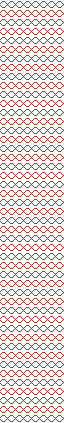
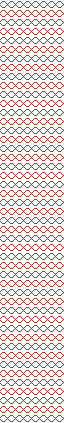
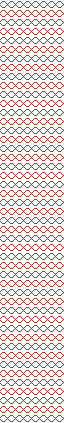
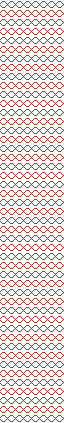
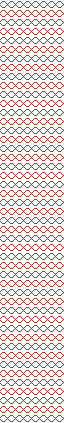
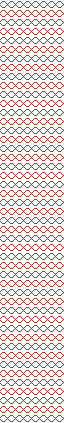
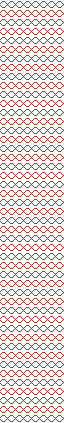
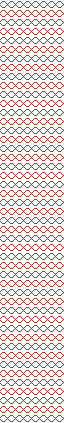
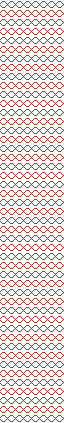
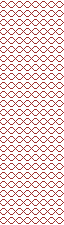
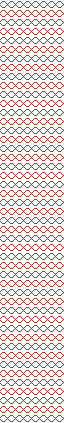
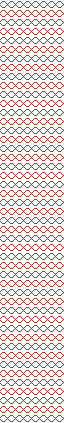
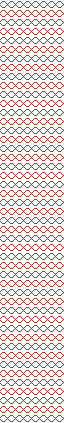
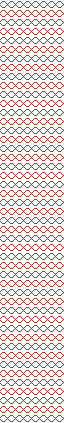

Im Jahre 1989 verschaffte ein lebhaft smartes Drehbuch von Nora Ephron dem Filmregisseur Rob Reiner die Gelegenheit, die Talente seiner beiden Hauptdarsteller Meg Ryan und Billy Crystal besser in Szene zu setzen, als das je wieder jemandem mit diesen beiden gelang. "Harry und Sally" war wohl deshalb ein so hübscher Film, weil er den beiden beliebtesten Spielarten des Redens über Liebe nach 1968 gleichermaßen eins auswischte.
Die eine Spielart, den Hippie-Schmu, Marke "Liebe besiegt das System", rückte er zurecht durch seine zärtlich genaue Illustration der Binsenweisheit, daß nur Menschen, die von den Mühen der Produktion (Geld!) und Reproduktion (Kinder!) durch verdeckte Ausbeutung Abwesender freigestellt sind, also Typen wie jene ganz schön ichsüchtigen New Yorker Endachtziger-Yuppies, um die es hier ging, so richtig toll verfilzte Liebeshändel zustande bringen.
Und die andere Spielart, den komplementären Verneiner-Kitsch, Marke "Das Private ist eine Falle und gehört politisch abgeschafft", wiederum beschädigte das unscheinbare Werk, indem es die Verrenkungen seiner beiden doch eigentlich moralisch vage verabscheuungswürdigen Schmarotzerhauptfiguren, wahrer Edelprodukte der von Ronald Reagan angetriebenen neuen Spekulationsökonomie (sie Hip-Journalistin, er Politikberater), einfach so putzig inszenierte, daß einem plötzlich dämmerte: Das wahre Menschheitsglück könnte vielleicht davon abhängen, daß man an dergleichen kuschliger Dekadenz wieder jene neurotische Utopie des extrem sinnlos Komplizierten schätzenlernte, die schon die Frühmoderne so liebte.
Fünfzehn Jahre und viele Enzykliken der progressiven Sexualforschung später inszeniert der Regisseur Loveday (!) Ingram im Theatre Royal am Haymarket in London eine Bühnenfassung von "Harry und Sally", bei der Marcy Kahan alles richtig gemacht hat, was Nora Ephron, der Urheberin der Vorlage, seither bei ihren Drehbüchern immer nur mißlungen ist, von "Schlaflos in Seattle" bis "E-Mail für dich". Kahans Theatertext erinnert an alle Stärken dieser Geschichte: Er ist historisch präzise und total herzig, verlegt die Jahre der ursprünglichen Erzählhandlung aus der Siebziger-Achtziger-Klammerwelt in die abschüssige Achtziger-bis-Zweitausend-Strecke, erwähnt genau die richtigen Fernsehshows ("West Wing" und "Jerry Springer"), "so retro, daß es schon wieder Avantgarde ist" (Harrys Exfrau über eine Kneipe). Auch die Videoeinspielungen von Langzeitpaaren – es sind natürlich zwei knuffige Schwule dabei – werden nicht mehr, wie im Film, unkommentiert gelassen, sie stammen hier von Sallys Freundin Marie, die neuerdings Videokunst fabriziert, und müssen sich von Harry als schmalzig abkanzeln lassen, wie denn schließlich dieser, im Film noch eine Art finster-zeitloser Existenzialist, der sich in Misanthropie und Thanatopsis suhlt, hier zum ruppig-geistreichen, seine nähere Umgebung präzis beobachtenden Sozialhäretiker geworden ist - das Vergnügen, Luke Perry das neo-nietzscheanische Adjektiv "über-ruthless" und Hauptwörter wie "fascists" und "corporate yuppies" ausspucken zu hören und zu sehen, gehört zu den erleseneren dieser Veranstaltung.
Wie genau Kahan weiß, worauf sie sich eingelassen hat, zeigt ihr Selbstverständigungstext in den Programmnotizen (bis man bei uns dergleichen in einem Boulevardstück-Begleitheftchen wird lesen können, müssen wohl erst noch ein paar Weltkriege verloren werden), und zwar sowohl inhaltlich – "Sie finden also einander, aber weil Harry ein depressiver, dominanter sexualler Opportunist ist und Sally eine lebhafte, romantische Zwangsneurotikerin (ich überteibe fast gar nicht), klappt erstmal gar nichts" – wie formal – "eigentlich ist dieser Stoff gar kein Film, verläßt sich nicht auf Bilder, sondern auf das 'langsame Abwickeln eines dicht geknüpften Arguments', wie der Dramatiker Christopher Hampton den typischen theatertext definiert hat." Wie damals bei Ephron und Reiner aber ist das Schönste an dieser ausgeklügelten Herangehensweise an den Stoff, daß ein Text, der die gräßlichen und die süßen Seiten seiner Hauptfiguren so genau kennt, vor allem den Schauspielern die auf dem Theater immer wünschenswerte Gelegenheit zum Glänzen bereitet. Sie können so anzüglich, capricenselig, materialistisch, verworren und albern sein, wie wir uns freie Menschen wünschen würden, wenn wir uns dergleichen nicht abgewöhnt hätten. Die Schauspieler nutzen diese Gelegenheit weidlich.
Gut die Hälfte des Publikums bei der Preview-Vorstellung am Mittwoch, man erkennt's am Alter, an den T-Shirts mit Aufdruck, an den Pausengesprächen, ist allein wegen der Sally-Darstellerin hier: Alyson Hannigan, bekannt als Willow Rosenberg aus der Fernsehserie "Buffy the Vampire Slayer" und als Michelle aus den sehr erfolgreichen "American Pie"-Filmen, stand noch nie auf einer Bühne und fühlt sich dort doch offenbar so wohl, als seien ihr Film und Fernsehen schon lange zu eng. Ihre Stimme trägt, ihre Gesten locken, ein ungeschickter Kuß zu Neujahr wird äußerst geschickt plaziert. Der Moment, auf den alle warten, der gespielte Orgasmus zum Zweck der Belehrung und Demütigung Harrys, erhält verdienten Szenenapplaus (und kriegt als Appendix noch einen der schönsten Kahanschen revisionistischen Drehs verpaßt: die Bestellung "I’ll have what she’s having" nach dem Höhepunkt gibt hier keine ältere Dame, sondern ein hübscher junger Mann auf).
Hannigan spielt trockener als Ryan seinerzeit, ihre Niedlichkeit ist zerebraler, süß auf herb statt süß auf verklemmt gewissermaßen – kleine Tics verbinden die Rolle mit anderen, so der spitze kleine Seufzer "Och" (mit schottisch-arabischem Kehllaut) als Erschöpfungszeichen, der liebevolle Seitenblick auf den Apple-Computer (now there’s our favourite technopagan Wicca), das Naserümpfen und die Art, wie sie ein Bettuch um den Leib wickelt (der an dieser Stelle erlebte Flashback zum entspannten Gekuschel in "Seeing Red" drängt dem Rezensenten nicht zum ersten mal die Frage auf, ob der Hang, überall und jederzeit Buffyreferenzen zu erblicken, eigentlich behandelt gehört oder lieber doch nicht). Hannigans Interpretation der Sally-Rolle kommentiert gleichsam das Schicksal derartiger Rollen seit 1989 mit, sie zielt auf eine Sorte Witz, die sich in Beziehungskomödien bereits auskennt, statt auf die kokette Unschuld des ersten Durchlaufs, trägt ihr buntes Fitness-T-Shirt in Übergröße samt käfergrüner Stretchhose, als wäre diese vergessene Kombination ein höfisch-elisabethantisches Kostüm, verspricht sich nur ein einziges mal (statt richtig in New York erklärt sie, eben erst in L.A. angekommen zu sein, wo diese Theaterfassung, im Gegensatz zur auf’s urbane 80s-Ostküsten-Flair stark abhebenden Filmfassung, in der Tat ganz genauso spielen könnte), führt mit grundverschiedenen Emotionen unterfütterte Arten des Sitzens auf Sofas vor (mal bedrängt von Harry, mal vertraut mit der besten Freundin)
und begeistert damit wie bestellt: Die Fans sind sich in der Pause einig, daß man nichts anderes von ihr erwartet hat. Sharon Small als Marie und Jake Broder als Harrys Freund Jack – im Film Jess – sind dagegen lediglich höchst sehenswert, nämlich auf eine sehr filmfremde Art textverliebt, ja pointenlüstern.
Neue Dialogzeilen (etwa die für ein Theaterstück bemerkenswert romanhafte Einsicht "Old people are lucky. They know their story") stören an keiner Stelle, die schönsten Unwiederholbarkeiten des Films werden durch adäquate funktionalen Entsprechungen ersetzt: den farbkompositorisch so ergreifenden Herbstspaziergang etwa erzeugt man mit einer Videoprojektion riesengroßer fallender Blätter, und die lange Autofahrt, bei der die beiden einander kennen lernen, wird zum mehrtägigen Anstreichjob für Harry in der Wohnung der eben in New York angekommen, vermittelt von der diesmal unsichtbaren Amanda (Harry, viel später: "Amanda Rice", Sally, empört. "Reese." Harry: "Sag‘ ich doch."). Harry vergreift sich, wie Billy Crystal im Auto, auch in Sallys Wohnung mehrfach vertrauenszerstörend im Ton, kriegt aber wenigstens die gewünschte Wand- und Deckenfarbe hin: "Eine an Weiß grenzende Weißschattierung", auf der sie, fully in character, eisern besteht.
Die eigentliche Überraschung aber bietet der männliche Star, Luke Perry. Crystals Film-Harry ist wohl nicht zu übertreffen, aber Perry, der ehemalige Teenie-Schwarm und in die Jahre gekommene "Beverly Hills 90210"-Fernsehstar, mault und schwärmt, poltert und gurrt, singt und zeigt komischen Körpereinsatz, bis auch die letzten verbitterten Überlebenden der Geschlechterkriege im Publikum ihm seine Sally gönnen. Man beklatscht ihn gern, den lustigen Menschen mit dem spärlicher werdenden Haar, diesen unzeitgemäßen, allein mit Charme und Lernwillen zum Ziel gelangenden Helden in erotisch hochverkorksten Zeiten.
Dietmar Dath
> nach oben