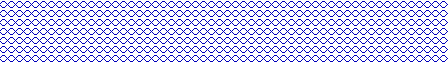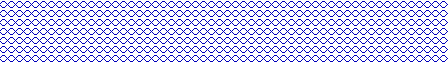

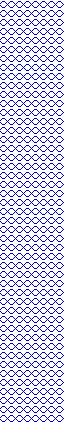
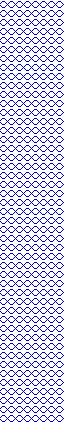
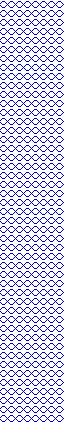
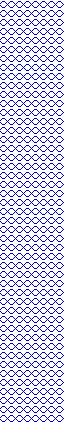
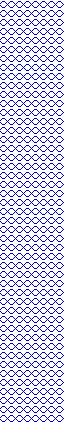
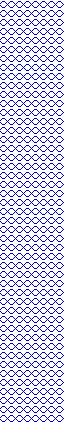
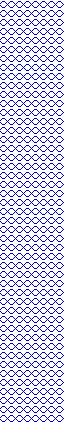
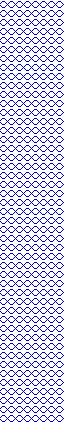
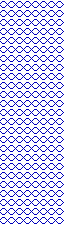
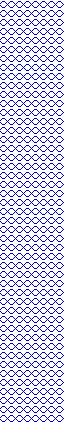
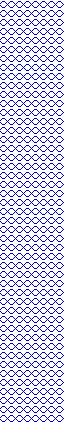
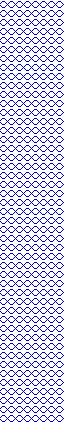
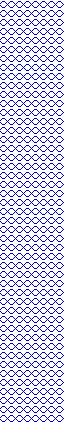
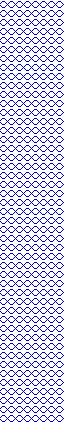
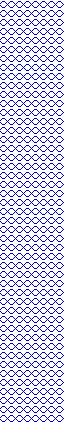
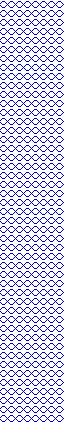
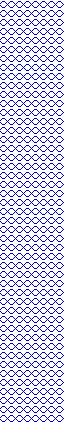
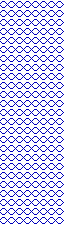

Amber Bensons "Chance"
(Was man also a.a.O. bestellen kann), ist einer jener Filme, die ihren Blick so idealtypisch auf eine ganz bestimmte Art des Erwachsenwerdens zu einer ganz bestimmten historischen Zeit werfen, daß man sich entweder daran freut, wie euphorisierend einem das Werk beim eigenen Erwachsenwerden hilft, oder aber froh ist, daß man den Film mit dem Kennerblick des Erwachsenen genießen darf, der um so klarer sieht, weil man's hinter sich hat. John Hughes' "Breakfast Club" von 1985 war so ein Film, mit Schwächen und teilweise überzuckert, aber doch wegweisend; Richard Linklaters "Slacker" (1991) bildete ab, was jene damals neue Rumhängerjugend ausmachte, die als erste Generation im reichen Westen nach dem Zweiten Weltkrieg schlechteren Einkommens- und Lebensplanungschancen ins Gesicht sah als die Eltern; der glatte, raffiniert sentimentale Beziehungsschinken "Singles" (1992) von Cameron Crowe verrührte Linklaters Perspektive dann mit allerlei MTV-erprobten "Grunge"- und "Alternative"-Lifestyle-Zutaten, kochte die Mixtur auf kleiner Flamme gar und schuf so dem modernen Teenager, aber auch dem Twenty- und inzwischen Thirtysomething ein harmlos renitentes Verkrachtheits- und Ziellosigkeitsimage, das als Marktkategorie bis heute vorhält und zahllosen Reality-TV-Produzenten den Maßstab leiht, an dem sie jene "Kids" eichen, die sie sich ausdenken.
"Chance" nun, der außergewöhnliche Film, den man hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen via Internet bestellen muß, handelt ebenfalls von jungen Leuten hart am Rande der Überflüssigkeit. Aber anders: unartiger, klüger, stellenweise fast schon richtig weise. Sein Titel bedeutet "Glück" oder "Zufall", meint aber auch den Namen der Hauptfigur – einer jungen Frau, die einigermaßen offen und immer bereit, zu staunen, durch ihr verwirrendes Mittzwanzigerdasein taumelt. Gespielt wird sie von Amber Benson, die in dieser Zeitung schon einmal porträtiert wurde (F.A.Z. vom 14. März 2003) und alles andere ist als ein taumelndes, kaum beschriebenes postpubertäres Blatt im Windkanal des Schicksals. Benson weiß, was sie kann und wohin sie will, sie hat den Film geschrieben, Regie geführt, einen der Songs auf dem Soundtrack komponiert und das Gesamtkunstwerk zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester produziert.
Anders also als beim kommerziellen Lebenshilfe-Krempel in der berechnend bewirtschafteten Zone zwischen "Shell"-Jugendstudie und "Generationen"-Fertigliteratur ist der Blick kein verklärender, mit dem diese Autorenkomödie ihre Heldin begleitet, die von Überweisungen der Mutter lebt und damit noch einen Mitbewohner, Gelegenheitsarbeiter und heimlich in Chance verliebten schwärmerischen Romantiker namens Simon (James Marsters) über Wasser hält. Diese jungen Leute stammen nicht aus der Turnschuhwerbung. Ihnen widerfährt eine Sorte ästhetischer Gerechtigkeit, die Kontext heißt: Sie haben Familien und außer Problemen auch Mut, Kraft, Geschick, eben alles, was die Verantwortliche zu den Dreharbeiten mitgebracht hat.

Chances Bruder, den wir im ganzen Film nicht sehen, der aber auf subtile Weise indirekt präsent ist, heißt "Zero" - der Vater fand das lustig, als er sich vorstellte, wie das wäre, die beiden zu rufen: "Come here, Zero, Chance" - Komm her, kein Glück, keine Chance. No Future: Als diese Kinder gezeugt und geboren wurden, wurde auch eine Musik, ein Lebensstil, eine Haltung gezeugt und geboren, die man "Punk" nennt: Amber Benson kam im Januar 1977 zur Welt, dem besten Jahr der "Sex Pistols".
Das Überraschendste und Charmanteste an "Chance" dürfte die für einen Film des Genres "Erziehung der Gefühle" unfaßbar locker unverstellte, nirgends im geringsten krampfgeplagte Art sein, mit der genau die schartige Unsentimentalität, für die Punk als Siegel stehen sollte, in den Dienst von etwas anderem genommen wird als ihrer bloßen Zurschaustellung, auf die Punk so oft hinauslief. Alles mögliche wird so ohne Angst angefaßt: Geschlechterfragen vor allem, Sexualitäten, Probleme zwischen dem One-Night-Stand, der Scheidung der Eltern und Aufwachen neben einer Toten. Der Schnorrer-Mitbewohner kauft der aus seiner Sicht wohlhabenden Heldin "female stuff", also Hygiene-Artikel, weil sie ihm das Geld fürs Gemüse auslegt. Er ist ein schöner Mann, riecht aber nicht gut. Als Chances Mutter vorbeischaut, um sich über ihre zerbröselnde Ehe auszuweinen, verwirren die beiden sie mit einem nie richtig erklärten Rollenspiel: Den ganzen langen Besuchstag gibt Simon mit Make-up und im leichten Sommerkleid vor, Chance zu sein, während Chance mit aufgemaltem Schnurrbart auf dem Sofa herumlümmelt und dumpfe Macho-Sprüche klopft. Bi- und Ambisexualitäten, ja, polymorphe Perversionen sind das Normalste der Welt: Chance schleppt eine Frau in der Disco ab, verliebt sich in einen schwulen Sänger (gespielt vom großen Andy Hallet, Musical-Held und Fernsehstar), der wiederum lieber dem süßen Simon an den Waschbrettbauch will. Unterdessen lebt Chances Vater mit seiner achtzehnjährigen Privatsekretärin zusammen. Was sich aber in der Wohnung tut, in der Simon und Chance leben, beobachtet stellvertretend fürs Publikum ein merkwürdiger Voyeur, der ansonsten vor allem von toten Käfern besessen ist.
Fragen über Fragen: Warum dürfen Frauen nicht auch einfach mal jemanden abschleppen und danach in den Wind schießen? Sind Eltern normal, die sich versöhnen, indem sie einander mit Shakespeare-Zitaten neu verführen? Wie viele unaufdringlich mutige filmische Tricks kann man so einer Geschichte entlocken?
Einige: Chance spricht in die Kamera, ihre Stimme begleitet auch Bilder, in denen sie nicht vorkommt, der Rhythmus ist voller geschickt geschnittener und verstotterter kleiner Synkopen, die Filmmusik wird behandelt wie im Videoclip - man sieht den Gitarristen und Komponisten Grant Langston spielen, er wird zwischendurch oder wenn die Songs anfangen oder aufhören, eingeblendet, wie er in Kulissen vorangegangener oder nachfolgender Szenen steht, singt und klampft.
Wie man die Fähigkeit, unsentimental, aber nicht naiv zu beobachten, was geschieht, in sich wachruft und pflegt, das sagt der Film auch. Als der verrückte, käfernekrophile Nachbar wegzieht, macht er Chance eins der schönsten denkbaren Komplimente: Er habe ihr Leben beobachtet, sagt er, und egal, wie schrecklich und hysterisch alles wird, sie lasse die Tür immer offen. Genau das ist der Grundtonfall des Films wie des Vertriebsexperiments, welches sich, wie eine Buchsubskription, ganz auf "die Leute", die Interessierten verläßt. Beides ist geglückt: Beim Sidewalk-Filmfestival von Birmingham, Alabama, hat "Chance" letztes Jahr den Publikumspreis erhalten; die Nachfrage nach der so kompliziert verbreiteten Video- und DVD-Version ist groß. Irgendwann wird man sie wohl auch auf herkömmlichen Wegen kriegen. Die Moral des Ganzen ist simpel: Der Film handelt von Risiken und Glück, das mediengeschichtlich sehr neuartige Schicksal, das er hatte, ebenfalls. Und bei einer derart ermutigenden Doppelgeschichte finden sich dann eben auch in Krisenzeiten genügend Herzen, alte und junge, zu denen das Wunder spricht. Wie sagt Amber Benson selbst so treffend? "Es wurde dann doch alles viel besser, als ich gedacht hatte."
Dietmar Dath
> nach oben